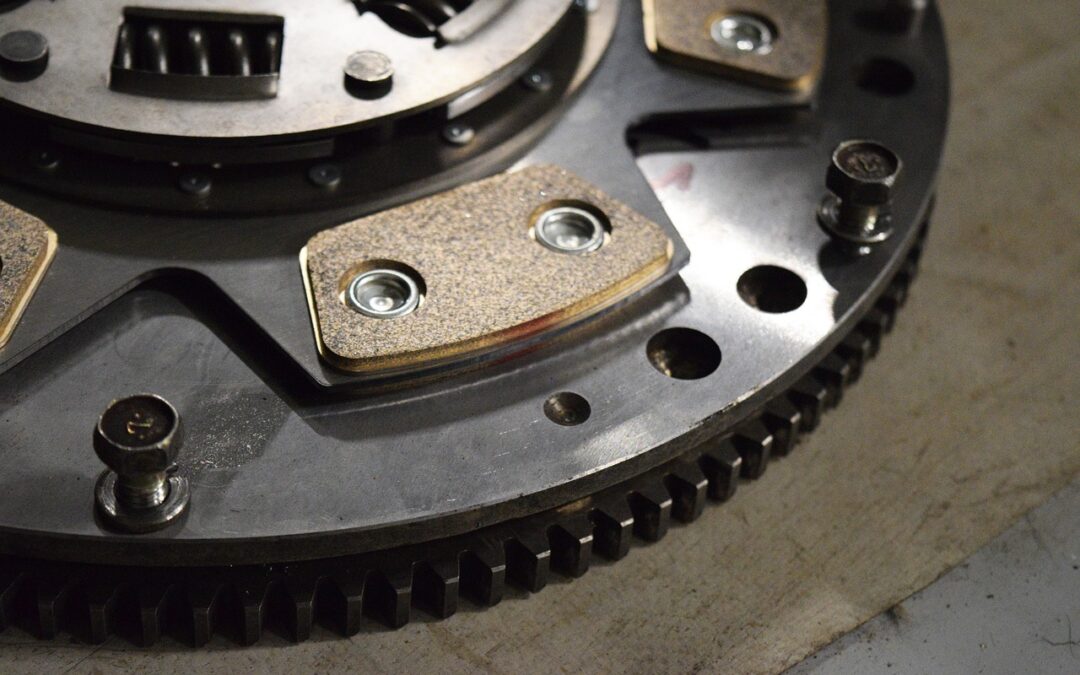Die Migration von SAP Process Integration/Process Orchestration (PI/PO) zu SAP Cloud Platform Integration (CPI) – als zentraler Bestandteil der SAP Integration Suite (IS) – ist weit mehr als nur ein technologisches Upgrade. Es ist eine strategische Weichenstellung auf dem Weg zur digitalen Transformation. Unternehmen, die diesen Schritt wagen, investieren aktiv in Flexibilität, Skalierbarkeit und eine zukunftssichere Integrationslandschaft. Eine erfolgreiche Migration erfordert eine klare Strategie, präzise Planung und ein diszipliniertes Vorgehen. Im Folgenden stellen wir alle relevanten Migrationsphasen systematisch vor und erläutern, warum und wie sie umzusetzen sind.

1. Bestandsaufnahme
Warum ist diese Phase essenziell?
Der Grundstock jeder Migration sollte eine umfassende Bestandsaufnahme sein. Ein vollständiges Verständnis von der bestehenden Integrationslandschaft vereinfacht die richtigen Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.
Was umfasst diese Phase?
- Inventarisierung aller aktuellen Schnittstellen: Welche Schnittstellen existieren? Welche Art von Daten ist Gegenstand der Übertragung? Handelt es sich um A2A (Application-to-Application), B2B/EDI oder BPM-basierte Prozesse?
- Klassifikation nach Aufwand und Komplexität: Nicht alle Schnittstellen sind gleich. Einige sind einfach migrierbar, andere erfordern eine umfangreiche Neukonzeption.
- Analyse der Abhängigkeiten: Viele Integrationen sind miteinander verknüpft. Änderungen an einer Schnittstelle können weitreichende Auswirkungen auf andere Prozesse haben.
- Überprüfung der Wiederverwendbarkeit: Bestehende Artefakte und SAPs vorgefertigter Content können die Migrationszeit erheblich verkürzen.
Diese gründliche Analyse bildet die Basis für die Priorisierung und Planung der nachfolgenden Schritte.
2. Zukunftsarchitektur
Was versteht man darunter?
In dieser Phase wird die zukünftige, Cloud-basierte Integrationsarchitektur entworfen, die auf den Erkenntnissen der ersten Phase aufbaut.
Wichtige Überlegungen
- Mapping zu CPI-Standards: Der Abgleich der alten Interfaces mit den verfügbaren CPI-Standardconnectors oder -Templates.
- Nutzung moderner IS-Dienste: Einbindung weiterer Dienste der SAP IS wie API Management, Event Mesh oder Open Connectors, um Flexibilität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit von Anfang an sicherzustellen.
- Definition von Governance-Regeln: Wie sollen Schnittstellen zukünftig benannt, dokumentiert, überwacht und gewartet werden? Klare Standards stellen die langfristige Wartbarkeit und Qualität sicher.
Ziel ist ein detailliertes Architekturdesign, das die technologische Basis für eine stabile, skalierbare und wartbare Cloud-Integration legt.
3. Parallelbetrieb und Pipeline-Konzept
Während der Migration ist der Parallelbetrieb beider Systeme – altes PI/PO und neue CPI – der Schlüssel zur Risikominimierung. Die laufende Geschäftstätigkeit bleibt ungestört, während die neue Umgebung schrittweise aufgebaut, getestet und optimiert wird.
Die Rolle des Pipeline-Konzepts
Pipelines sind im PI/PO-Umfeld zentrale Bausteine zur Nachrichtenverarbeitung. In CPI wird dieses Konzept modernisiert, sodass Integrationsszenarien auf modularen, flexiblen Flows basieren. SAP bietet standardisierte Pipeline Templates und Packages in CPI an, die speziell dafür entwickelt wurden, Migrationen zu erleichtern. Diese Vorlagen erlauben es, typische PI/PO-Pipelinestrukturen (z. B. Sender-/Empfängerlogik, Routing, Transformation) effizient in der Cloud abzubilden. Sie verkürzen die Migrationszeit erheblich, da sie wiederverwendbare Muster und Skripts (z. B. für Partnerbestimmung oder Fehlerbehandlung) enthalten.
Wie erfolgt die Umsetzung?
- Die Migration erfolgt idealerweise in kleinen, überschaubaren Sprints und agile Methoden sorgen für schnelle Feedbackzyklen.
- Bestehende Logik wird refaktoriert, um von Cloud-Vorteilen wie Skalierbarkeit und Resilienz zu profitieren.
4. Sicherheit durch Prüfung
Sicherheit und Stabilität haben oberste Priorität. Die Voraussetzung für die produktive Freigabe der Schnittstelle ist das Bestehen aller Tests..
Was ist zu testen?
- End-to-End-Funktionstests, um sicherzustellen, dass die Prozesse wie geplant laufen.
- Regressionstests, um zu verhindern, dass Änderungen unbeabsichtigte Nebenwirkungen auf bestehende Anwendungen haben.
- Performance-Tests für die Überprüfung von Durchsatz, Latenz und Stabilität unter Last.
- Fehler- und Exception-Handling-Tests, damit mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkannt und zuverlässig behandelt werden.
5. Kontrollierter Übergang
Der Umschaltprozess muss geplant und schrittweise erfolgen.
- Geplant erfolgt eine schrittweise Umschaltung der produktiven Schnittstellen von PI/PO auf CPI.
- Monitoring-Tools innerhalb von CPI unterstützen eine Echtzeit-Überwachung der laufenden Integrationsprozesse.
- Endgültige Abschaltung der alten Plattform erst dann, wenn die neue Umgebung durchgängig stabil arbeitet und alle operativen Anforderungen erfüllt.
Dieser kontrollierte Übergang vermeidet Systemausfälle und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
6. Kontinuierliche Optimierung
Die Migration ist kein Abschluss, sondern der Beginn einer nachhaltigen Optimierungsphase. Die Nutzung moderner Analysetools, KI-gestützter Überwachung und ereignisgesteuerter Automatisierung schafft eine selbstoptimierte Landschaft.
Was aktuell möglich ist?
- Regelmäßige Performance- und Fehleranalysen.
- Automatisierte Skalierung bei erhöhter Nutzung.
- KI-basierte Erkennung und Behebung von Anomalien.
- Nutzung von Event-Driven-Architekturen zur flexiblen Erweiterung von Integration.
Diese Maßnahmen machen die Integrationsarchitektur widerstandsfähig und zukunftssicher.
Jetzt die Cloud-Vorteile erschließen
Der Übergang von SAP PI/PO zu SAP CPI und damit SAP IS ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sorgfältige Planung, die Nutzung moderner Pipeline Templates und umfassende Tests erfordert. Durch eine strukturierte, phasenorientierte Vorgehensweise sichern Sie die Stabilität, Performance und Zukunftsfähigkeit Ihrer Integrationen und erschließen gleichzeitig die unschlagbaren Vorteile der Cloud: Agilität, Skalierbarkeit und eine reduzierte Total Cost of Ownership (TCO). Sind Sie bereit, Ihre Integrationslandschaft Cloud-nativ zu gestalten? Wir unterstützen Sie dabei!